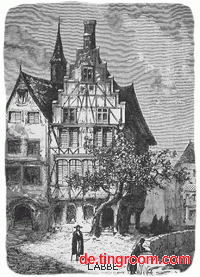Es war der 24. Mai 1863. An diesem Sonntag kam mein Onkel, Professor Lidenbrock, auf sein kleines Haus in der Königsstraße 19 zugeeilt. Es war eines der ältesten Häuser in diesem Viertel in Hamburg und die gute Martha musste glauben, dass sie sich mit dem Mittagessen verspätet hatte. Erschrocken rief sie: "Ach je, da kommt ja Herr Lidenbrock." "Ja, Martha.", beruhigte ich sie. "Aber es ist noch Zeit. Die Uhr der Michaeliskirche hat eben erst halb zwei geschlagen." "Warum kommt er denn so früh?", beschwerte sich Martha und verschwand vorsichtshalber schnell in ihrem kulinarischen Laboratorium und überließ es mir, meinen jähzornigen Onkel zu beruhigen. Da ich aber ein eher unentschlossener Charakter bin, zog ich es vor, eben so schnell wie Martha zu verschwinden.
Leise schlich ich mich in mein Zimmer, während ich unten die Haustür in den Angeln knirschen hörte. Die Treppe knarrte und der Herr des Hauses eilte durch das Esszimmer in sein Arbeitszimmer. Auf dem Weg dorthin rief er schon nach mir: "Axel, komm her!" Ehe ich mich bewegen konnte, rief er ein zweites Mal: "Wo bleibst du so lange?" So schnell ich konnte, eilte ich in das Arbeitszimmer meines furchtbaren Gebieters.
Otto Lidenbrock war kein böser Mensch, das gebe ich gern zu. Aber er war sehr eigenartig und würde als schrecklicher Sonderling sterben, wenn er sich nicht noch sehr änderte. Am Johanneum war er Professor und hielt Vorlesungen über Mineralogie. Ob seine Schüler etwas lernten oder nicht war ihm herzlich egal. Er war ein sehr egoistischer Gelehrter, der nur für sich und nicht für die anderen lehrte. Manchmal blieb er in seinen Vorlesungen einfach stecken, musste mit einem störrischen Wort kämpfen, das ihm nicht über die Lippen wollte, um sich schließlich in einen wenig wissenschaftlichen Fluch zu flüchten. Ich will nichts Schlechtes über die Wissenschaft sagen, schon gar nicht, wenn man mit Wörtern wie rhomboëdrischen Kristallisationen, retinasphaltischen Harzen oder Mangantungstaten umgehen soll. Aber in der Stadt kannte man die Schwäche meines Onkels und lauerte geradezu darauf, dass gefährliche Stellen seine Zunge zum Straucheln brachten.
Auch wenn hin und wieder über ihn gelacht wurde, so war mein Onkel doch ein wirklicher Gelehrter. In ihm verband sich das Genie des Geologen mit dem Blick des Mineralogen und sein Name hatte in der wissenschaftlichen Welt einen guten Klang. Er war ein großer, hagerer Mann, hatte eine eiserne Gesundheit und wirkte durch sein blondes Haar zehn Jahre jünger als seine tatsächlichen fünfzig Jahre. Er trug eine starke Brille, hinter deren Gläsern sich seine Augen beständig bewegten. Beim Gehen machte mein Onkel Riesenschritte und ballte seine Hände zu Fäusten. Sein Temperament war zeitweilig aufbrausend und ich war auf seine Gesellschaft nicht allzu erpicht.
Für einen deutschen Professor war mein Onkel reich. Das Haus in der Königstraße 19, das ein wenig schief und krumm da stand, gehörte ihm, mit allem, was dazu gehörte. Und das waren Martha, die Haushälterin, Grete, sein siebzehnjähriges Mündel und ich. In meiner doppelten Eigenschaft als Waise und sein Neffe, wurde ich der Laborgehilfe. Die geologischen Wissenschaften machten mir Spaß und in Gesellschaft meiner kostbaren Steine wurde mir nie langweilig. Auch wenn mein Onkel zu Ungeduld und Reizbarkeit neigte, konnte man in dem kleinen Haus, das halb aus Holz und halb aus Ziegeln bestand, recht glücklich leben, wenn man zur rechten Zeit das Rechte tat. Gehorchen! So schnell ich konnte, eilte ich in sein Arbeitszimmer.
 英语
英语 日语
日语 韩语
韩语 法语
法语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语