Am 24. April 1923 erscheint Freuds “Das Ich und das Es“. Seitdem gilt, dass das Ich ein armes Ding und nicht Herr im eigenen Haus sei, als ein Standardmodell der Psychologie. Autorin: Justina Schreiber
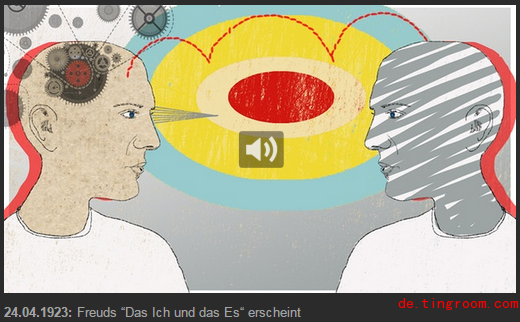
Ein Foto, das viele kennen: die mit einem Perserteppich belegte Couch Sigmund Freuds. Weinrot, wuchtig, weich. Wie eine Höhle. Hier lagen sie also und sprachen von ihren Träumen, Ängsten und Trieben. Während der Vater der Psychoanalyse am Kopfende saß, immer mit der Zigarre in der Hand. Vornehmlich Frauen der Oberschicht vertrauten ihm ihre Schlafzimmergeheimnisse an, ihre verbotenen Phantasien; sie sprachen von Mordgelüsten, hysterischen Anfällen oder Darmstörungen. Sigmund Freud ordnete das seelische Chaos für sie. Sortierte Triebwünsche von Schuldgefühlen, schälte hier den Penisneid heraus und dort einen verdrängten Konflikt. Erstaunlich, was er so alles ans Licht brachte. Seine Erkenntnisse fügte er zu einer großen wissenschaftlichen Theorie zusammen, zu einer “metapsychologie“, wie er es nannte. Den letzten grundlegenden Baustein veröffentlichte er am 24. April 1923 mit der Schrift “Das Ich und das Es“.
Alles, was danach folgte, war Feinschliff oder Arabeske.
Das “Ich“ ist ein armes Ding
Zunächst aber stellte er also die drei Instanzen vor, die den psychischen Apparat des Menschen bestimmen: Das Es, das Ich und das Über-Ich sowie ihre Beziehungen untereinander. Sein niederschmetterndes Ergebnis gleich vorneweg: Das Ich spielt leider nur eine kleine Rolle im Seelenhaushalt, so sehr es sich auch bemüht, die Oberhand zu bekommen. Es sei ein “armes Ding“, wie Freud mitleidig anmerkte. Ein Spielball der beiden anderen Parteien. Es und Über-Ich verbündeten sich manchmal regelrecht, um ihm eins auszuwischen. Von wegen Willensfreiheit also. Der Seelendeuter hatte Grund zu der Annahme, dass das Ich ganz selten selbst-bewusst handelt. Vielmehr trickst es meist übel herum,
weil es nämlich jegliche Form von Unlust vermeiden will.
Und die droht ihm eben durch Es und Über-Ich: mal von unten als drückender Triebstau, mal von oben als Verbot des strengen Gewissens.
Wie schwer es doch ist, Herr im eigenen Haus zu sein! Nicht, dass Freud privat diese Erfahrung gemacht hätte. Im Gegenteil: Ehefrau Martha hielt ihm wunschgemäß das ganze Leben lang den Rücken frei. Die sechs Kinder störten nie, wenn der Vater fremde oder eigene Gefühlswelten sezierte, um den verborgenen Mechanismen des Lustprinzips auf die Schliche zu kommen.
Anna, die jüngste Tochter, ließ sich von ihm sogar höchstpersönlich analysieren. Wobei er hinter ihren masochistischen onaniephantasien den unbewussten Wunsch entdeckte, dass Freud nur sie liebe.
Eros und Todestrieb
Ein ziemlich starker Tobak also, den der Sohn eines armen Wollhändlers da aus den unbewussten Schichten der menschlichen Seele herausfilterte.
Die Widerstände in der Fachwelt waren dementsprechend groß. Aber es gelang ihm dann doch, die Psychoanalyse als quasi wissenschaftliches Verfahren zu etablieren. Dennoch trübte ein pessimistischer Ton seine späteren Schriften. Das Massenmorden des ersten Weltkriegs, der frühe Tod seiner Tochter Sophie im Jahr 1920 und etwas später der des Lieblingsenkels Heinele verdüsterten den Horizont des jüdischen Patriarchen.
Als der 66-Jährige sein ernüchterndes Drei-Instanzen-Modell zu Papier brachte, stand ihm die erste von über 30 Krebsoperationen bevor. Die Idee, dass im Menschen neben dem Eros eine mindestens ebenso starke, zerstörerische Kraft wirksam ist, erschien ihm nun immer plausibler. Freud arbeitete unverdrossen bis zu seinem Tod im September 1939 weiter.
Und obwohl seine Theorien zur Sexualität des Säuglings längst als überholt gelten, kann der Wiener Nervenarzt einen posthumen Triumph doch verbuchen:
die moderne Hirnforschung bestätigt seine Annahme, dass das Ich ein
“armes Ding“ sei. Denn die Grundlagen unserer Wünsche und Handlungen bleiben uns letztlich fremd. Es sei denn, wir legen uns auf die Couch.  英语
英语 日语
日语 韩语
韩语 法语
法语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语

