Hinter jedem großen Mann steht eine patente Frau. In diesem Fall eine mit blutendem Finger und vorwurfsvoller Mine. Der Gatte findet das Heilmittel, indem er den Würfelzucker erfindet - als verletzungsungefährliche Alternative zum Zuckerhut. Autorin: Silvia Topf
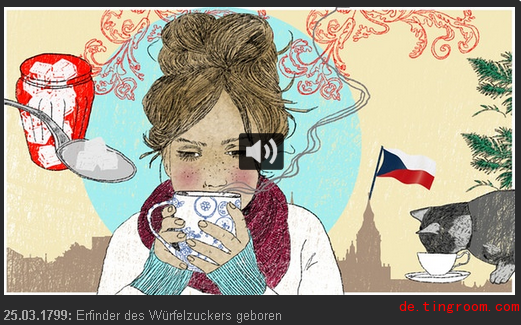
Es kann ganz harmlos anfangen: Man kommt - na, sagen wir nach Wien - da geht man, wenn man schon einmal da ist, auch ins Café Sacher. Die berühmte Torte wird serviert, dazu eine Melange, doch dann zögert man, und der Würfelzucker versinkt nicht im Kaffee, sondern wandert in die Handtasche; ein kleines Andenken nur, aber vielleicht auch der Grundstein für eine ganze Sammlung.
Dass Zuckersammler in Deutschland, "Sucrologists" in Großbritannien oder "Glycophiles" in Frankreich ihrem Steckenpferd reichlich Zucker geben können ist ja eigentlich erst seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts möglich, als man aus hygienischen Gründen begann, die kleinen Zuckerportionen in Papierchen einzuwickeln und diese als Werbeträger zu nutzen. Auf den Markt gekommen war der Würfelzucker allerdings schon gut ein halbes Jahrhundert früher. So berichtete im Jahr 1843 eine Wiener Zeitung über eine "neue Art Zucker in Würfelform", die "vorzüglich den ökonomischen Damen gefällt". Zu verdanken hatten die ökonomischen Damen den neuartigen Würfelzucker Jakob Christoph Rad, dem findigen Direktor der Zuckerraffinerie im mährischen Daschitz.
Gib den Damen Zucker
Rad war in der napoleonischen Umsturzzeit am 25. März 1799 im vorderösterreichischen Rheinfelden zur Welt gekommen, wo sein Vater in der Militärverwaltung diente. In Wien absolvierte Rad eine Drogistenlehre, doch erst seine Frau Juliana, die er mit vierzig Jahren ehelichte, ebnete ihm den Weg zum süßen Erfolg.
Vor rund 150 Jahren gab es Zucker nur in Form von Zuckerhüten, die bis zu eineinhalb Meter groß waren. Diese steinharten kegelförmigen Monster mussten dann mit viel Kraft und Geschick und mit Hilfe von Folterwerkzeugen nicht unähnlichen Gerätschaften wie Zuckerhammer, Zuckerhacke, Zuckerbrecher oder Zuckerzangen in handliche Stücke gebrochen und dann im Mörser zerstampft werden. Das war körperliche Schwerarbeit, die nicht immer ohne Blessuren abging, so dass oft statt Wohlgerüchen Schmerzensschreie aus der Küche drangen.
Und so passierte es eines schönen Tages auch Frau Direktor Rad: Aus ihren zarten Fingern floss Blut und sickerte in den für die Kaffeetafel gebrochenen Zucker. Den so verdorbenen Zucker warf die sparsame Hausfrau natürlich nicht in den Müll, dazu war Zucker zu kostbar. Sie brachte die rot-weiße Mischung mit bandagierten Fingern zu Tisch. Diese verfluchten Zuckerhüte! Konnte sich ihr Mann denn nichts Kleineres ausdenken? Am besten wären doch Würfel!
Würfel statt Verband
Rad begann zu experimentieren, und bald hatte er auch die einfache aber geniale Lösung gefunden: Mit Hilfe von Blechstreifen konstruierte er eine unseren Eiswürfelbehältern nicht unähnliche Form, raspelte den Zuckerhut, feuchtete den so abgelösten Zucker an, füllte ihn in die Form und ließ die Würfel trocknen. Nun mussten nur noch die technischen Voraussetzungen für die serienmäßige Herstellung geschaffen werden. Auch das war bald geschehen, und im Januar 1843 erhielt Rad das kaiserliche Patent zur Herstellung von Zucker in Würfelform, der als "Thee-Zucker" oder "Wiener Würfelzucker" in den Handel kam und bald nicht nur in Wien begeisterte Aufnahme fand.
 英语
英语 日语
日语 韩语
韩语 法语
法语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语

